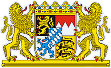Bestandserhaltung
Die Bestandserhaltung ist eine wichtige archivische Fach- und Führungsaufgabe. Sie umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Archivgut vor Beschädigung und Vernichtung zu bewahren. Es handelt sich nicht nur um eine historisch-kulturelle Aufgabe, sondern um einen im Archivgesetz formulierten gesetzlichen Auftrag an die staatlichen Archive. Die Bestandserhaltung stellt sich in der Praxis als ein Bündel von Maßnahmen dar. Neben der Instandsetzung (Konservierung und Restaurierung) und den verschiedenen Maßnahmen der Reprographie (archivische Fotografie und Digitalisierung) kommt der Prävention von Schäden eine entscheidende Bedeutung zu.
Fördermöglichkeiten Bestandserhaltung
Bundesfördermittel (KEK)
Seit zehn Jahren unterstützt das Bundesministerium für Kultur (BKM) über die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) den Originalerhalt in Deutschland.
Im Sonderprogramm der KEK gefördert werden Bestandserhaltungsmaßnahmen wie Massenentsäuerung, Trockenreinigung, Verpackung, Restaurierung sowie Konzept- und Methodenentwicklung (z.B. Schadenserfassung). Der Haushaltsansatz der KEK für Förderungen im Jahr 2021 (Ende der Antragsphase: 31.1.2021) beträgt 3,5 Millionen Euro.
Für bayerische Archive ist die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns zentrale fachliche Stelle für die Antragskoordination. Alle bayerischen Archive – unabhängig vom Träger – werden bei der Antragstellung beraten, die Anträge inhaltlich und fachlich koordiniert sowie gesammelt an das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst zur Gegenzeichnung weitergegeben. Die Weiterleitung der Anträge an die KEK erfolgt durch das Ministerium. Auch für das kommende Jahr 2024 können bis Ende Januar 2024 wieder Anträge gestellt werden. Um nicht in zeitliche Schwierigkeiten zu geraten, sollte mit der Vorbereitung der Antragstellung spätestens im Herbst 2023 begonnen werden. Zur Wahrung der Fristen benötigt die Generaldirektion die Anträge bis 11.12.2023.
KEK-Modellprojekt 2023 der Staatlichen Archive Bayerns für den Notfallverbund München:
DEZENTRAL LAGERN, GEMEINSAM BEWÄLTIGEN Notfallboxen und Schulung für den Notfallverbund München
KEK-Modellprojekt 2021 der Staatlichen Archive Bayerns:
"Schadensprävention am Schreibtisch –Bestandserhaltungsboxen für den Alltag mit Archivgut"
↗ KEK-Pressemitteilung 2021 - Projekte im Überblick
Landesfördermittel (Kulturfonds)
Aus Mitteln des Kulturfonds werden kulturelle Projekte in Bayern gefördert. Eine Förderung ist auch in Kombination mit einer Förderung durch die KEK möglich, eine rechtzeitige und langfristige Planung ist aber notwendig. Antragsfrist beim Kulturfonds ist jeweils zum 1. Oktober.
Notfallvorsorge
Notfallverbünde
Hochwasser, Brand und andere Katastrophenfälle stellen für Archive, Bibliotheken, Museen und andere kulturgutverwahrende Einrichtungen eine existentielle Gefahr dar. Die Katastrophenfälle und Großschadensereignisse der jüngeren Zeit zeigen, dass diese Gefahren durch den Klimawandel eher zu- als abnehmen. Um im Notfall nicht ganz alleine dazustehen, schließen sich kulturgutverwahrende Einrichtungen in Notfallverbünden zusammen. Die beteiligten Institutionen sichern sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegenseitige Unterstützung zu, um Ressourcen zu bündeln sowie die schnellere und effektivere Bergung und Erstversorgung der betroffenen Archivalien, Bücher und Ausstellungsstücke zu gewährleisten. Eine Notfallvereinbarung umfasst unter anderem: gemeinsame Schulungen und Übungen, die Ausarbeitung von Notfallplänen sowie den permanenten fachlichen Austausch der Verantwortlichen untereinander und mit externen Partnern wie der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk.
Mit der Gründung des Notfallverbundes Coburg haben die Staatlichen Archive Bayerns 2023 ihr Ziel erreicht, an jedem ihrer Archivstandorte einen Notfallverbund zu etablieren.
Verbünde bestehen in:
- Amberg-Sulzbach-Rosenberg (gegründet 2019)
- Augsburg (gegründet 2015)
- Coburg (gegründet 2023)
- Bamberg (gegründet 2019)
- Nürnberg (gegründet 2016)
- Landshut (gegründet 2019)
- München (gegründet 2016)
- Würzburg (gegründet 2022)
Weitere Informationen zur Arbeit von Notfallverbünden in Deutschland sind zu finden unter:
http://notfallverbund.de/
Die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes (KEK) berücksichtigt die Notfallvorsorge in ihren Förderlinien und unterstützt u.a. den Ankauf von Notfallboxen und anderer Ausrüstung oder die Ausarbeitung von Notfallplänen. Eine Übersicht bisher geförderter Projekte im Bereich Notfallvorsorge ist über die Homepage der KEK abrufbar:
https://www.kek-spk.de/projektliste?term=notfall
Ebenfalls auf der Homepage der KEK bereitgestellt wird eine interaktive Übersichtskarte aller Notfallverbünde in Deutschland:
https://www.kek-spk.de/notfallverbundkarte/#/
Der SicherheitsLeitfaden Kulturgut (SiLK) bietet Archiven, Bibliotheken und Museen mit einem kostenfreien Online-Tool die Möglichkeit, in einer Selbstevaluation das Sicherheitsniveau der eigenen Einrichtung zu erheben und Schwachstellen aufzudecken:
https://www.silk-tool.de/de/
Die gemeinsamen Empfehlungen zum Notfallmanagement in Archiven und Bibliotheken der Bund-Länder-Gremien wurden 2024 neu gefasst und sind hier abrufbar.
Notfallrahmenplan
Die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns hat 2001 einen Notfallrahmenplan ausgearbeitet, der sich nicht nur auf eigene Erfahrungen und neue Erkenntnisse sowie Anleitungen der Gefahrenabwehrbehörden stützt, sondern sich auch an das Vorbild der Notfallplanungen der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg, des Westfälischen Archivamts in Münster und der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena anlehnt. Im Einzelnen enthält der Notfallrahmenplan vor allem einen Katalog von Empfehlungen für technische Vorkehrungen und organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung oder Begrenzung von notfallbedingten Schäden an Archivgut sowie Anleitungen für die Notfallbewältigung (Muster für Ablauf- und Alarmplan), für Sofortmaßnahmen zur Rettung von wassergeschädigtem Archivgut und für Nachsorgemaßnahmen.
Der Rahmenplan gibt in der hier veröffentlichten Fassung den Kenntnisstand von 2001 wieder. Eine Überarbeitung und Aktualisierung auf der Grundlage der aus der Flutkatastrophe von 2002 gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse sowie der Ergebnisse der Arbeitsgruppe "Notfallvorsorge" des Restaurierungsausschusses der Archivverwaltungen des Bundes und der Länder ist vorgesehen.
Lokale Notfallplanung in den Archiven
Auf der Grundlage dieses Rahmenplans haben das Bayerische Hauptstaatsarchiv und die Staatsarchive Amberg, Augsburg, Bamberg, Coburg, Landshut, München, Nürnberg und Würzburg eigene, an die individuellen baulichen Gegebenheiten und Anforderungen angepasste Notfallpläne erarbeitet. Als erste Schritte wurden in Zusammenarbeit mit den örtlichen Gefahrenabwehrbehörden Analysen der Gefährdungspotenziale durchgeführt und daraus resultierende Präventivmaßnahmen in die Wege geleitet. Im Zusammenhang mit der Adaptierung des Muster-Ablauf- und Alarmplans wurden vorsorglich mit technischen Diensten, Speditionsfirmen und Kühlhäusern Kontakte aufgenommen und deren Adressen und Rufnummern für den Ernstfall festgehalten.
Für die Evakuierung von gefährdetem oder bereits geschädigtem Archivgut entwarfen die Archive teils ausführliche Bergungspläne mit Prioritätenlisten und farbiger Markierung der jeweiligen Rettungswege in den dazugehörigen Magazinplänen, teils begnügten sie sich damit, die Türen zu Magazinbereichen, in denen herausragende Archivaliengruppen lagern, zu kennzeichnen.
In jedem der staatlichen Archive wurden Notfallgruppen aufgestellt, wobei die „mobile Notfallgruppe“ des Hauptstaatsarchivs, die sich vor allem aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bestandserhaltungsreferats zusammensetzt, im Bedarfsfall den Notfallgruppen der Staatsarchive Hilfe leistet. Alle Archive verfügen inzwischen über Notfallboxen, die eine Grundausstattung für den Notfall enthalten: vor allem Schutzausrüstung sowie Hilfsmittel und Materialien für die sachgerechte Verpackung von durchnässten Archivalien. Bei einer kleinen Notfallübung konnten in der Restaurierungswerkstätte des Bayerischen Hauptstaatsarchivs die für die Notfallboxen beschafften Materialien auf ihre Praktikabilität und Funktionstüchtigkeit getestet werden. An Hand von zur Kassation frei gegebenen Akten und Büchern, die zuvor 24 Stunden lang im Wasser gelegen waren, wurde das Verpacken von wassergeschädigtem Schriftgut für die Tiefgefrierung und anschließende Gefriertrocknung geübt; damit wurde das Ziel verfolgt, beim Eintreten eines echten Notfalls lähmende Unsicherheit zu vermeiden und schnelles und richtiges Handeln zu gewährleisten. Schulungen für das Personal sowie Brandschutzübungen haben bereits stattgefunden bzw. sind geplant.