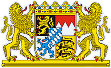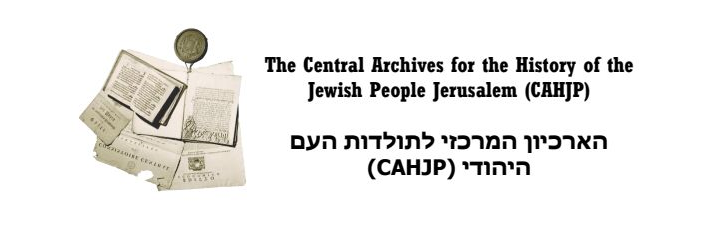Projekt „Digital Nuremberg Military Tribunals“ („DigiNMT“)

Das Staatsarchiv Nürnberg verwahrt mit der Sammlung „Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse“ die bedeutendste schriftliche Überlieferung zu den Nürnberger Prozessen. In einem Kooperationsprojekt mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW) und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) werden diese Unterlagen nun vollständig digitalisiert und mit Mitteln der Digital Humanities wissenschaftlich aufbereitet.
Die Nürnberger Prozesse, d.h. der internationale Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess (1945-1946) und zwölf durch die US-Regierung durchgeführte Nachfolgeprozesse (1946-1949), sind heute ein Meilenstein des Völkerstrafrechts. Die Prozesse waren ein Beleg dafür, dass nicht durch Rache, sondern mit den Mitteln des Rechts die Untaten des „Dritten Reiches“ gesühnt wurden. Den Millionen von Opfern des NS-Regimes sollte mittels gerichtlicher Verfahren Gerechtigkeit zuteil werden. Bis heute liefern die Prozessdokumente wichtige Erkenntnisse für die Rechts- wie die Zeitgeschichte und die Erforschung des Umgangs mit der nationalsozialistischen Vergangenheit.
Die Bayerische Akademie der Wissenschaften (BAdW), die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und die Staatlichen Archive Bayerns ermöglichen mit dem Projekt „Digital Nuremberg Military Tribunals“ („DigiNMT“) die wissenschaftliche Aufarbeitung der Nürnberger Nachfolgeprozesse mit Mitteln der Digital Humanities anhand der zentralen Überlieferung des Staatsarchivs Nürnberg. Durch gezielte Ansprache der Anklagebehörde und der Verteidigung gelang es dem Staatsarchiv Nürnberg nach 1946 umfangreiches Aktenmaterial zu den Prozessen zu übernehmen und für die Nachwelt zu sichern. Von den ursprünglich knapp 1,4 laufenden Kilometern an Sammlungsgut blieben nach der Nachkassation von Doppelstücken und Abgaben an andere Institutionen 394 laufende Meter an Kernüberlieferung, was etwa 2,5 Millionen Blatt entspricht. Der Bestand enthält offizielle Unterlagen der Prozesse (z.B. Anklageschriften, Protokolle, Schriftsätze, Beweismittel, Gerichtsorders, Urteile, Gnadenverfahren) sowie umfangreiches Material der Anklage und der Verteidigung. Besonders einzigartig sind die Anklagedokumente mit einem Umfang von allein 950.000 Blatt in verschiedenen Serien (NG, NI, NO, NOKW, PS sowie kleinere Dokumentenreihen). Hinzu kommen rund 40 Nachlässe/Depots von den damaligen Prozessverteidigern, die teilweise zusätzlich umfangreiches Material zu den Dachauer Prozessen beinhalten, insbesondere zu „Lynchmorden“ an alliierten Fliegern und Konzentrationslagerverbrechen.
Die Unterlagen der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse werden in einem ersten Schritt von 2025 bis 2026 durch die Staatlichen Archive Bayerns digitalisiert und soweit rechtlich möglich, über die Findmitteldatenbank der Staatlichen Archive Bayerns online zugänglich gemacht. Für die Onlinestellung müssen die vorhandenen Verzeichnungsdaten nach einheitlichen Standards überarbeitet werden. Die erzeugten Digitalisate und Metadaten dienen der FAU im nächsten Projektschritt als Ausgangspunkt für die durch Künstliche Intelligenz (KI) und Natural Language Processing (NLP) unterstützte Verschlagwortung sowie die rechts- und geschichtswissenschaftliche Kommentierung, die im Rahmen eines gesonderten Internetauftritts und durch interaktive Visualisierungen der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollen. Sichtbar gemacht werden damit komplexe Zusammenhänge zwischen Akteurinnen und Akteuren, Beweismitteln und juristischen Konzepten.
Kontakt: Dr. Hubert Seliger
Tel.: +49 (89) 28638-2490
E-Mail: poststelle@gda.bayern.de
Projekt „Transformation der Wiedergutmachung“
Zugänglichmachung von Archivgut des Freistaates Bayern zu Rückerstattung und Entschädigung über das Themenportal „Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts“
Die Staatlichen Archive Bayerns verwahren eine nach Umfang und Inhalt höchst bedeutende archivische Überlieferung zur „Wiedergutmachung“ von NS-Unrecht. Hierzu zählen im Bayerischen Hauptstaatsarchiv Akten des Landesentschädigungsamts (LEA), des Landesamts für Vermögensverwaltung und Wiedergutmachung (LAVW) sowie zentralbehördliche Sachakten. In den Staatsarchiven wird hingegen die Überlieferung der fünf bayerischen Wiedergutmachungsbehörden sowie die der bayerischen Finanzmittelbehörden verwahrt.
Mit Projektbeginn im April 2023 wurden zunächst die Bestände der Wiedergutmachungsbehörde I für Oberbayern aus dem Staatsarchiv München bearbeitet. Gefördert vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) werden bis 2030 auch Akten des Landesentschädigungsamts und der bayerischen Ministerien digitalisiert und tiefenerschlossen. Die Metadaten und Digitalisate sollen unter Beachtung der rechtlichen Maßgaben auf dem Themenportal „Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts“ online bereitgestellt werden.
Zuständig für die „Wiedergutmachung“ nationalsozialistischen Unrechts war seit den frühen 1950er Jahren das BMF. Die Bundesländer wirkten im Rahmen des föderalen Staatsaufbaus an der Ausgestaltung der bundesgesetzlichen Regelungen mit, deren Vollzug bis heute in die Zuständigkeit der Landesbehörden fällt. Opfer des Nationalsozialismus konnten Entschädigungs- und Rückerstattungsanträge bei den zuständigen Ämtern der westlichen Bundesländer vorbringen. „Wiedergutmachung“ konnte dabei das unermessliche Leid, das den Opfern von NS-Unrecht zugefügt wurde, nicht aufwiegen, sondern den Betroffenen und Ihren Hinterbliebenen nur materielle Unterstützung gewähren.
Hunderttausende solcher „Wiedergutmachungsakten“ in bayerischen Archiven dokumentieren, wie die Entschädigungs- und Rückerstattungsgesetze in der deutschen Nachkriegszeit umgesetzt wurden. Sie belegen sowohl die NS-Verbrechen im Einzelfall als auch den Umgang des demokratischen Rechtstaats mit diesem schweren Erbe. Die Akten zeigen, wie die Behörden im Einzelfall entschieden haben und welche Unterschiede und Widersprüche trotz geltender gesetzlicher Regelungen dabei auftraten.
In absehbarer Zeit werden keine Überlebenden von Shoah, Porajmos und NS-Terror mehr unter uns weilen. Für die Demokratie- und Identitätsgeschichte Deutschlands besteht jedoch auch zukünftig die Verpflichtung, dauerhaft an das Leid der Verfolgten zu erinnern und ihr Andenken zu bewahren. Aus dieser Verpflichtung heraus ergeben sich Folgeaufgaben der „Wiedergutmachung“, die das BMF unter anderem mit dem Aufbau des Themenportals „Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts“ umsetzt.
Das Portal wird von der Deutschen Digitalen Bibliothek DDB im Archivportal-D bereitgestellt und führt Informationen zu den einschlägigen Archivbeständen zum Thema der „Wiedergutmachung“ von Bund und Ländern, kommunalen und freien Archivträgern zusammen. Weitere relevante Archivträger werden ebenso in das Gesamtprojekt eingebunden wie Wissenschaft, Forschung und andere gesellschaftliche Stakeholder. Projektbezogene Angebote der Öffentlichkeits- und historisch-politischen Bildungsarbeit ergänzen das Vorhaben. Für die Familien und Nachkommen der Verfolgten selbst bergen die Akten oftmals wertvolle und teils unbekannte Hinweise zur eigenen Familien- und Identitätsgeschichte.
Kontakt:
Dr. Fabienne Huguenin
Tel.: +49 (89) 28638-3033
E-Mail: poststelle@gda.bayern.de
Kooperationsprojekt der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns mit den Central Archives for the History of the Jewish People (CAHJP)
Nach der Pogromnacht vom 9. November 1938 beschlagnahmte das Deutsche Reich widerrechtlich die schriftliche Überlieferung der jüdischen Kultusgemeinden in Bayern. Etliche Gemeindearchive gelangten zunächst in die Obhut der Staatlichen Archive Bayerns. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses Schriftgut an die Jewish Historical General Archives (JHGA), die Vorgängereinrichtung der Central Archives for the History of the Jewish People (CAHJP) in Jerusalem übergeben. Auf diese Weise sollte die Überlieferung der jüdischen Gemeinden in Jerusalem konzentriert und den zerstörten jüdischen Gemeinden sowie ihren Mitgliedern ein würdiges Denkmal gesetzt werden.
Die Archive der jüdischen Kultusgemeinden sind wichtige und viel genutzte Quellen für Forschungen zur jüdischen Geschichte Bayerns sowie Deutschlands. Die Unterlagen spiegeln weite Bereiche des Gemeindelebens wider: von der Gemeindeleitung (Statuten und Protokollbücher) über das Wirtschaftsleben (Rechnungsunterlagen) bis hin zum Schul- und Begräbniswesen, dem Rabbinat oder der örtlichen Festkultur. Der freie digitale Zugang zu den Gemeindeunterlagen war daher ein seit langem gehegter Wunsch lokal wie international vernetzter Forscherinnen und Forscher.
Auf Initiative des Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe und mit finanzieller Unterstützung durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, schloss die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns 2022 eine Kooperationsvereinbarung mit den CAHJP. In einem auf fünf Jahre angesetzten Projekt werden die Unterlagen von rund 200 jüdischen Gemeindearchiven digitalisiert und online über die Findmitteldatenbank der Staatlichen Archive Bayerns zugänglich gemacht.
Der Umfang der einzelnen jüdischen Gemeindearchive ist sehr unterschiedlich. Viele Bestände kleiner Landgemeinden umfassen nur wenige Akten, andere dagegen bestehen aus 200, teilweise sogar aus mehr als 500 Archivalien. Besonders umfangreich ist die Überlieferung bedeutender Kultusgemeinden mit langer, bis in die Frühe Neuzeit zurückreichender Geschichte wie Bamberg und Fürth.
Die digitalisierten Unterlagen der jüdischen Gemeinden sind recherchierbar in der Findmitteldatenbank der Staatlichen Archive Bayerns.
Mehr Informationen zum Projektstart „Digitalisierung der Überlieferung der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern“ finden Sie in der Pressemitteilung.
Ein Online-Vortrag von Prof. Dr. Michael Brenner, Inhaber des Lehrstuhls für Jüdische Geschichte und Kultur am Historischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München, auf unserem YouTube-Kanal informiert über Geschichte und Bedeutung jüdischer Gemeindeüberlieferung in Bayern.
Das nach Ortsnamen gegliederte Themen-Portal zur Geschichte jüdischen Lebens in Bayern, gehostet vom Haus der Bayerischen Geschichte, verknüpft vielfältige Informationen.
Kontakt:
Dr. Alexis Hofmeister
Tel.: +49 (89) 28638-2614
E-Mail: poststelle@gda.bayern.de
Nationale Forschungsdateninfrastruktur
Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) ist eine Initiative der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern. Es handelt sich dabei um eine digitale, verteilte Infrastruktur, die der Wissenschaft Dienste und Beratungsangebote rund um das Management von Forschungsdaten anbietet. Die NFDI wird von Bund und Ländern im Zeitraum 2019–2028 mit einem Förderumfang von ca. 85 Millionen Euro pro Jahr finanziert. Insgesamt werden bis zu 30 verschiedene Konsortien gefördert. Die Bewilligung erfolgt nach und nach in drei Förderrunden.
Die NFDI befindet sich aktuell im Aufbau. Sie entsteht aus einem von der Wissenschaft betriebenen Prozess als vernetzte Struktur eigeninitiativ agierender Konsortien. Diese Konsortien organisieren sich fachgruppen- oder methodenspezifisch mit dem Ziel Zugang und Management zu den für sie relevanten Forschungsdaten zu gewährleisten und nachhaltig zu gestalten. Ihre Akteure kommen sowohl von Hochschulen als auch außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Ressortforschungseinrichtungen, Akademien, Gedächtnisinstitutionen und anderen öffentlich geförderten Informationsinfrastruktureinrichtungen. Die Konsortien sollen folgende Ziele umsetzen:
- Nachhaltige, qualitative hochwertige und systematische Sicherung, Erschließung und Nutzbarmachung von Forschungsdaten über regionale und vernetzte Wissensspeicher
- Etablierung eines Forschungsdatenmanagements nach den FAIR-Prinzipien, welche einen Qualitätsstandard der Daten garantieren, indem die Daten auffindbar (Findable), zugänglich (Accessible), interoperabel (Interoperable) und wiederverwendbar (Re-usable) sind.
- Anbindung und Vernetzung mit internationalen Initiativen wie der European Open Science Cloud.
Für eine umfassende Wirksamkeit, Vernetzung und dem Anspruch einer gemeinsamen deutschen NDFI tragen Basisdienste bei, mit denen die infrastrukturelle Grundversorgung für potenziell alle Konsortien gewährleistet und Interoperabilität dauerhaft gesichert werden. Die einzelnen NFDI-Konsortien sollen sich über Querschnittthemen finden und an gemeinsamen Lösungen arbeiten. Als Überbau der NFDI fungiert dabei sowohl ein NFDI-Direktorat als auch ein im Oktober 2020 gegründeter Verein.
Die Staatlichen Archive Bayerns unterstützen den Aufbau und die Fortentwicklung einer NFDI aktiv und beteiligen sich an mehreren Konsortien. Sie bringen sich mit ihren Kompetenzen bei der Langzeitspeicherung, Langzeitarchivierung, dem Management prozessgeborener Daten, der Umsetzung von Archivierungsschnittstellen sowie eigenen Datenbeständen und nicht zuletzt mit ihrem Netzwerk im Bereich Archive und Forschungsinstitutionen in den Konsortien NFDI4Biodiversity (bewilligt 2020), NFDI4Earth (bewilligt 2021), NFDI4Memory, NFDI4Objects, FAIRagro sowie in der NFDI-Sektion „Common Infrastructures“ in der Arbeitsgruppe „Langzeitarchivierung“ ein.
Mehr Informationen finden Sie auf folgenden Seiten:
https://www.dfg.de/foerderung/programme/nfdi/
Kontakt:
Dr. Lina Hörl
Tel.: +49 (89) 28638-3035
E-Mail: poststelle@gda.bayern.de
NFDI4BioDiversity (Oktober 2020 – September 2025)
Das NFDI4BioDiversity-Konsortium ist ein Zusammenschluss von Fachkreisen sowie Interessengruppen einschließlich der Bürgerwissenschaften, citizen science, und staatlicher Behörden im Bereich Umwelt- und Naturschutz für Biodiversität, Ökologie und Umweltdaten sowie von Infrastruktureinrichtungen. Gemeinsames Ziel ist es, Wissen aus verschiedenen Bereichen miteinander zu verknüpfen und so Zugang zu dezentralen Daten zu schaffen. Sowohl die Integration, Nutzung und Verbreitung von Biodiversitätsdaten als auch die gemeinsame Verbesserung von Daten und Services sowie Aufbereitung von Informationen für eine dauerhafte Sicherung und Nachnutzung sollen verwirklicht werden. Eine Grundlage für die Integration solcher Daten bieten die FAIR-Prinzipien, welche einen Qualitätsstandart der Daten garantieren, indem die Daten auffindbar (Findable), zugänglich (Accessible), interoperabel (Interoperable) und wiederverwendbar (Re-usable) sind.
Die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns bringt ihre Kompetenz und Expertise bei der Langzeitarchivierung in der Rolle eines „Participant“ ein und arbeitet in den Aufgabenbereichen, Task Areas, nationale und internationale Vernetzung (2connect) sowie an der nachhaltigen Bereitstellung von Daten, Werkzeugen und Diensten, Zertifizierung (2consolidate) mit.
Mehr Informationen finden Sie auf der offiziellen Projektseite.
NFDI4Memory

Die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns unterstützt als Participant das Konsortium NFDI4Memory. Das Konsortium vereint ein breites Spektrum historisch arbeitender Geisteswissenschaften sowie weitere Disziplinen, die historische Daten methodisch nutzen, und bewahrende Einrichtungen wie Bibliotheken, Museen, Archive und Infrastruktureinrichtungen. Ziel ist eine neue Wissensordnung für die digitale Zukunft der Vergangenheit. Das Engagement der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns konzentriert sich dabei auf die Task Areas „Data Quality“, „Data Connectivity“ und „Data Literacy“. Durch das Einbringen archivischer Kompetenzen soll darüber hinaus das FAIR-Prinzip (FAIR = Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) im Forschungsdatenmanagement gefördert werden.
Mehr Informationen finden Sie auf der offiziellen Projektseite.